5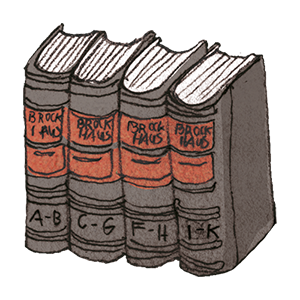
Lettern, Farbe und Papier
In einem Paralleluniversum stünde Leipzig nicht auf Braunkohleflözen, sondern auf Lagerstätten unzähliger Bücher, und durch die Adern der Leipziger würde statt Blut Druckerschwärze fließen. Übertreibung? Nur vielleicht.
Seit der Erfindung der beweglichen Lettern war die Stadt im Buchdruck involviert. Zwar hatte Frankfurt über Jahrhunderte die Nase vorn, doch was der einen die Nähe zu Gutenbergs Mainz, war der anderen Luthers Wittenberg. In der Leipziger Druckerei von Melchior Lotter zum Beispiel wurden nach 1517 neben vielen anderen Schriften des Reformators auch die berühmten 95 Thesen gesetzt.
Die große Buchzeit begann dreihundert Jahre später. Die Zahl der Verlage explodierte, das herstellende Gewerbe expandierte und eroberte mit dem Grafischen Viertel städtischen Innenraum. Das Adressbuch von 1900 offeriert fast tausend Verlage und Buchhandlungen, rund vierhundert Druckereien und Buchbindereien. Kurz vor dem ersten Weltkrieg arbeitete jeder zehnte Leipziger mit oder am Buch, hatte die Stadt mit der Bugra 1914 die weltgrößte Buchmesse und seit 1927 die Internationale Buchkunst-Ausstellung.
Die erste Zäsur kam 1933, von der zweiten im Dezember 1943 erholte sich Leipzig nicht mehr: das Grafische Viertel sank in Schutt und Asche und mit ihm geschätzt 50 Millionen Bücher. Nach dem Krieg gingen die meisten Verlage in den Westen und Frankfurt übernahm die Krone.
Dennoch blieb die Stadt neben Berlin wichtigster Buchort der DDR und hatte mit der Messe einen begehrten Ausblick auf sonst schwer erreichbare Literatur. Der Aufbruch nach 1989 und Entwicklungen rund um das geschriebene Wort haben die Situation erneut verändert. Aber immer noch steht Henselmanns Hochhaus wie ein aufgeschlagenes Buch über der Stadt, als sei es aus einem der magischen Flöze gewachsen.